
- geb. 10.4.1824 in Graslitz (Böhmen, Österreichisch-Ungarische Monarchie, heute Kraslice, Tschechien)
- gest. 24.12.1914 in Wien
Österreichischer Lebensmittelhändler; Gründer der Großhandelsfirma Julius Meinl AG.; Sohn des Bäckermeisters Franz Anton Meinl und dessen Ehefrau Anna, née Dotzauer; absolvierte eine Lehre im Farbwarengeschäft eines Onkels in Prag. Im Jahr 1862 eröffnete er ein Delikatessengeschäft in der Köllnerhofgasse beim Lugeck und verkaufte dort auch “täglich frisch gebrannten Kaffee“, bevor er 14 Jahre später zahlungsunfähig war; allerdings gelang es ihm, das Geschäft nach einem Ausgleich weiterführen. 1891 eröffnete er die erste Röstfabrik und 1894 in Wien in der Neustiftgasse 28 im 7. Bezirk die erste Filiale. Die Unternehmensleitung übersiedelte 1899 in das vom Architekten Max Kropf erbaute Handelshaus am Fleischmarkt 7 in Wien; Kropf erbaute zwischen 1904 und 1905 auch die Schokoladefabrik Julius Meinl AG in der Heigerleinstraße 74-Ecke Paletzgasse.
 |
Meinl-Zentrale in Ottakring (ca.1912)![]()
Meinl etablierte sich mit eigenen Rohkaffee-Mischungen erfolgreich im Kaffeehandel. Der Rohkaffee wurde von den Konsumenten am heimischen Herd in der Pfanne geröstet, so daß Erzeugung und Handel von Kaffee den Kernbereich der Firma ausmachte. Als Markenzeichen seines Geschäftes ließ er von dem Wiener Plakatkünstler Joseph Binder (*1898, †1972) den Meinl-Mohr entwerfen, einen schwarzen Kinderkopf mit roter arabisch-türlischer Kopfbedeckung (Fez) auf gelben Hintergrund (nach einer Rassismus-Debatte wurde ab 2004 die Figur ganz in rot dargestellt).
Im Februar 1913 schied Meinl aus der Firma aus und übergab seinem Sohn Julius Meinl (II) ein Filialnetz, das sich über die gesamte Monarchie Österreich-Ungarn erstreckte.
Ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
Inschrift:
Es geht vorüber
Ehe ich’s gewahr werde
Und verwandelt sich
Ehe ich’s merke



Wien, Dornbacher Friedhof
- geb. 11.5.1891 in Berlin
- gefallen 22.5.1915
Sohn von Siegfried Loevy, des bekannten jüdischen Berliner Bronzegießereibesitzers; Nachfahre Samuel Abraham Loevys (*1826, †1900), der Mitte des 19. Jahrhunderts als Gelbgießer aus der preußischen Provinz Posen nach Berlin kam und dort die Gelbgießerei S. A. Loevy gründete.
Im Laufe der Jahrzehnte fertigte die Gießerei unzählige Einzelstücke sowie Kleinserien an Plastiken. Größte Skulptur war ein sechs Meter hohes Dioskuren-Paar von Eberhard Encke. Aufmerksamkeit erregten sie mit Tür- und Möbelbeschlägen aus den Perioden des Jugendstils und Art déco. Viele bekannte Designer und Architekten der Periode entwarfen für die Bronzewarenfabrik: Henry van de Velde, Peter Behrens, Bruno Paul, Heinrich Straumer, Walter Gropius, der für Loevy insbesondere den heute sogenannten Gropius-Türdrücker entwarf, Ludwig Mies van der Rohe, Erich Mendelsohn und Wilhelm Wagenfeld.
Das Unternehmen zählte ab Reichsgründung 1870/71 zu den wichtigsten Lieferanten von baubezogenen Bronzewaren in Berlin. Zahlreiche Banken und Hotels, aber auch Verkehrs- und Verwaltungsbauten, wie der Bahnhof Friedrichstraße, das Kaiserliche Reichspostamt oder das Preußische Kultusministerium wurden von Loevy mit Beschlägen und anderen Bronzearbeiten ausgestattet.
Nach dem Umzug der Gießerei im Jahre 1897 auf das Grundstück von Siegfried Loevys Schwiegervater in die Gartenstraße 158 (ab 1904 durch Umnummerierung Nr. 96), begann die produktivste Phase des Unternehmens: S.A. Loevy entwickelte sich binnen weniger Jahre zur führenden Bronzegießerei in Berlin. Sie lieferte nicht nur Materialien für Bauten in Berlin, sondern v.a. in die preußisch verwalteten Reichsgebieten, aber auch in die Schweiz, wo man bereits 1897 Werbung in der Schweizer Bauzeitung geschaltet hatte, und nach Norwegen wurden Beschläge geliefert.
1916, mitten im Ersten Weltkrieg, wurde auf dem Architrav an der Westseite des Reichstagsgebäudes die nach einem Entwurf von Peter Behrens aus zwei erbeuteten französischen Kanonenrohren der Befreiungskriege von S.A. Loevry gegossene Inschrift DEM DEUTSCHEN VOLKE angebracht.
Nach der “Machtübernahme” der Nationalsozialisten im Jahre 1933 wurden zahlreiche Familienmitglieder verfolgt, ermordet oder in die Emigration getrieben.


Berlin-Mitte, St. Elisabeth Kirchhof
- geb. 20.1.1886 Altdorf (heute OT von Ettenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg)
- gest. 3.9.1964 in Frankfurt am Main
Deutscher Koch und Unternehmer; einer Steinmetzfamilie entstammend, hielt Eugen sich vorzugsweise in der Küche des Gasthaus in Ettenheim auf, das seine Mutter nach dem frühen Tode ihres Mannes führte, und faßte den Entschluß, Koch zu werden. So machte er nach dem Besuch der Realschule in Ettenheim eine Ausbildung zum Koch, unter anderem bei Louis Nassoy, dem früheren Leibkoch Kaiser Napoleons III., im Hotel “Sonne“ in Lahr.
Nach seinen “Wanderjahren” durch führende Gastronomie-Etablissements in Deutschland und im Elsass sowie in Kombüsen der Passagierschiffe des Norddeutschen Lloyd nach Amerika oder in den Speisewagen der Compagnie Internationale des Wagon Lits kam er erstmals 1903 nach Frankfurt am Main, wo er in zwei gastronomischen Unternehmen tätig war.
1908 kehrte er zur Mutter zurück, die mittlerweile in Straßburg ein Weinrestaurant führte. Nach dem Endes des Ersten Weltkrieges, an dem er als Soldat teilnahm und verwundet wurde, mußte er das Elsaß verlassen, das gemäß des Versailler Vertrags zu Frankreich kam.
Über Heidelberg und Mannheim kam er schließlich 1920 wieder nach Frankfurt am Main und gründete dort im Stadtteil Sachsenhausen im Folgejahr ein ”Unternehmen zur Herstellung erlesener Delikatessen und feiner Conserven“ und die 1923 in Niederrad die ”Conservenfabrik Eugen Lacroix KG“, die als erstes Produkt getrüffelte Gänseleberpasteten anbot, die er in einer ehemaligen Metzgerei herstellte.
Bekannt wurde das Unternehmen vor allem durch seine Dosensuppen. In den 1950er Jahren profitierte das Unternehmen von dem Nachholbedarf der bundesrepublikanischen Bevölkerung nach dem Krieg, der u.a. in der sogenannten “Freßwelle” zum Ausdruck kam, und entwickelte das Unternehmen zum weltweit größten Hersteller von Schildkrötensuppen - so wurden z.B. im Jahre 1959 250 Tonnen Schildkröte verarbeitet; schließlich wuchs das Unternehmen auf 350 Mitarbeiter an und bot neben der Haifischflossensuppe auch andere exotische Produkte wie Suppen aus Seegurken oder Känguruschwänzen an.
Eugen Lacroix war als einziger Deutscher in derAcademie Culinaire de France ausgezeichnet.
Auszeichnungen u.a.: Bundesverdienstkreuz am Bande, Ehrenplakette der Stadt Frankfurt.


Frankfurt am Main-Sachsenhausen, Südfriedhof
- geb. 21.12.1945 in Straßburg
- gest. 23.1.2022 in Vincennes (Dép. Val-de-Marne)
Französischer Modedesigner und Photograph; Sohn eines Arztes, dessen Familie aus Linz (Österreich) in den Nachkriegswirren des Zweiten Weltkrieges nach Straßburg gezogen war, nahm - nicht zur Freude seiner Eltern - ab seinem neunten Lebensjahr klassischen Tanzunterricht und trat im Alter von vierzehn Jahren demBallett der Opéra du Rhin bei. Seine Erfahrungen in dieser Zeit prägten sein professionelles Arbeitsleben. Er studierte Kostümdesign an der École supérieure des Arts Décoratifs in Straßburg (seit 2011 Haute école des arts du Rhin, HEAR). In seiner Freizeit gestaltete er seine eigene Kleidung.
Ende der 1960er- Jahre zog Mugler nach Paris und gründete das Mode- und Kosmetikunternehmens Thierry Mugler SAS mit Sitz in Paris, das sich seit 1997 vollständig im Besitz von Clarins befindet. 2019 haben Arbeitnehmervertreter von L’Oréal und der Clarins Gruppe eine Vereinbarung über den Verkauf der Marke Mugler unterzeichnet. Mit Abschluß dieser Vereinbarung übernahm L’Oréal den Geschäftsbereich Fragrances von Clarins und somit die Marke Mugler und Thierry Mugler (Mode)



Paris, Cimetière du Père Lachaise
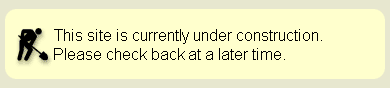

Carl Kellner auch Karl Kellner

- geb. 26.3.1826 in Hirzenhain (Großherzogtum Hessen, heute hessischer Wetteraukreis)
- gest. 13.5.1855 in Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis)
Deutscher Unternehmer, Optiker; zweites von vier Kindern von Albert Philipp Kellner, Hüttenverwalter der Buderus’schen Eisenhütte in Hirzenhain, und seine Frau Johanna Elisabeth, née Rudersdorf (*1792,†1848), aus Haiger; Carl besuchte bis zu seinem 17. Lebensjahr die Lateinschule in Braunfels. Anschließend wurde er Lehrling bei dem Mechaniker Messerschmied Philipp Caspar Sartorius in Gießen und soll parallel dazu Mathematkunterricht bei dem Gründer der Gießener Realschule Georg Stein (*1810,†1884) genommen haben. Anschließend ging Kellner nach Hamburg zu A. Repsold & Söhne,,einem Betrieb, der für seine hochwertigen optischen, besonders astronomischen Instrumente bekannt war, wo er Moritz Hensoldt aus Sonneberg, einen Kollegen, kennenlernte, der später viele mechanische Arbeiten für ihn ausführen wird.
Anschließend zog Kellner wieder zu seinen Eltern, die inzwischen nach Braunfels umgezogen waren, und begann ein Selbststudium der Optik, wobei Kellners Hauptaugenmerk astronomischen Fernrohren galt. Nachdem er erkannt hatte, daß man die sphärische Aberration (Verzerrungen) verbessern könnte, entwickelte er verkittete Fernrohrobjektive1, die den zeitgenössischen zweilinsigen Objektiven von Fraunhofer, Herschel und anderen Herstellern als überlegen erwiesen.
Spätestens ab 1847 beschäftigte sich Kellner mit einer wesentlichen Verbesserung der zeitgenössischen Okulare. Kellner entwickelte und stellte Teleskope und Mikroskope her und erlangte .erste Bekanntheit als Entwickler und Produzent des heute nach ihm benannten Kellner-Okulars. Seine Geräte wurden nach ganz Deutschland und ins Ausland geliefert und fanden in Wissenschaftskreisen Anerkennung für ihre Qualität. Das von ihm in Wetzlar gegründete Optische Institut war die Keimzelle der Wetzlarer optischen Industrie. Diese Werkstatt hatte unter Kellner bis zu 12 Mitarbeiter. In den knapp sechs Jahren unter seiner Leitung wurden etwa 130 Mikroskope und etwa 100 kleine und große Teleskope und Fernrohre produziert. Über mehrere Jahre hinweg arbeitete Kellner eng mit seinem Freund Moritz Hensoldt zusammen, der einen weiteren Wetzlarer Optikbetrieb gründete.
Verheiratet war Carl Kellner seit Dezember 1852 mit Maria, née Werner (*1830, †1881), die Adoptivtochter seines ehemaligen Lehrers Stein. Aus der Verbindung ging ein Sohn hervor, der allerdings die Geburt (13.4.1854) nur um einen Tag überlebte. Zu dieser Zeit war Kellner bereits an Lungentuberkulose erkrankt, wobei eine Kur sich als erfolglos erwies.
Bei Kellners frühem Tod waren über 130 Mikroskope, mindestens 5 große astronomische Teleskope und zahlreiche Handfernrohre aus seiner Werkstatt hervorgegangen, die zuletzt ein Dutzend Mitarbeiter beschäftigte.
Kurz vor seinem Tode erlebte Kellner Anfang des Jahres 1855 noch die Verleihung der vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. gestifteten “Goldmedaille für hervorragende gewerbliche Leistungen“.
Nach Kellners Tod wurde der Betrieb von seinem ehemaligen Mitarbeiter Friedrich Belthle weitergeführt. Nach dessen Tod 14 Jahre später wurde er von Ernst Leitz übernommen und unter dem Namen Leitz zu einem der größten Mikroskophersteller und Optik-Unternehmen der Welt ausgebaut. Nach mehreren Konzernfusionen und Aufspaltungen) heißt die Mikroskopsparte heute Leica Microsystems und die Kamerasparte Leica Camera; beide Unternehmen haben ihren Hauptsitz bis heute in Wetzlar.
_______________________________________________________________ _
1 ”Verkitten“ bedeutet, zwei optische Elemente mit Kitt so zu verbinden, daß diese nahtlos, also ohne Luftzwischenraum, ineinander übergehen, so daß keine Reflexion mehr auftritt.
Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis), ehem. Friedhof (heute Rosengärtchen)
Hinweis: Der Originalgrabstein des Familiengrabes war vermutlich anläßlich der Auflösung des Friedhofs nach dem Ersten Weltkrieg verloren gegangen; bei dem oben abgebildeten Stein handelt es sich um einen Gedenkstein, der erst 1926 errichtet und 1949 erneuert wurde.
- geb. 21.10.1905 in Kirchspielsgemeinde Havnbjerg Sogn auf der Insel Alsen (heute Elsmark)
- gest. 27.8.1966 beim Transport von Elsmark nach Sønderborg
Dänischer Fabrikant; Sohn des Landwirts und Hofbesitzers Jørgen Clausen (*1875, †1949) und dessen Frau Maren, née. Frederiksen (*1878 †1948); besuchte nach Abschluß der Oberrealschule in Sønderborg das Maschinenbautechnikum in Odense, das er 1927 als Ingenieur abschloß. Anschließend arbeitete er unter anderem für Brdr. Gram in Vojens, Silkeborg Maskinfabrik und Thrige in Odense.
1933 folgte die Gründung seiner Firma unter dem Namen Danfoss. Bekannt wurde er in den 1950er Jahren durch sein erstes Produkt, ein thermostatisches Heizkörperventil. Der wirtschaftliche Aufschwung stellte sich allerdings erst nach der Energiekrise in den 1970er Jahren ein. 1968 war Danfoss der erste serienmäßige Hersteller von Frequenzumrichtern - die von Danfoss Drives unter dem Warenzeichen VLT vertriebenen Geräte ermöglichen die Drehzahlregelung von Drehstrommaschinen.
Bis Ende der 1950er Jahre hatte sich Danfoss zur größten Fabrik Europas für Automatik-Teile von Kühl- und Heizungsanlagen sowie hermetische Kältekompressoren entwickelt. Im Jahr 1961 wurde Danfoss in eine Aktiengesellschaft mit Fabrikant Mads Clausens Fond als Hauptaktionär und Mads Clausen als Geschäftsführer umgewandelt.
Nach dem Tode Mads Clausens war dessen aus Haderslev stammende Frau, Dorothea Emma Andkjær, née Hinrichsen (”Bitten Clausen” *1912, †2016)1 mit der er seit 1939 verheiratet war, bis 1971 Vorstandsvorsitzende und dann bis 1988 stellvertretende Vorsitzende.
Clausen starb in der Folge eines Herzanfalls während der Fahrt des herbeigerufenen Krankenwagen in das Landeshospital in Sønderborg. Seine Beisetzung erfolgte unter großer Anteilnahme der Bevölkerung: 10.000 Menschen säumten die Strecke des Leichenwagens zum Friedhof und waren :Ausdruck auch, daß Mads Clausens Verdienst nicht nur in der 1933 erfolgten Gründung des späteren Weltkonzerns Danfoss in Südjütland bestand; er wurde auch dafür anerkannt, daß er sich stets gegen eine Verlagerung des Hauptwerks in Nordals entschieden hat.
_____________________________________________________ _
1 Aus der Verbindung gingen fünf Kinder hervor: Karin Clausen (*1940), Bente Clausen (*1942), Jørgen Mads Clausen (*1948), Peter Johan Mads Clausen (*1949) und Henrik Mads Clausen (*1953).


Nordborg (Reg. Syddanmark), Havnbjerg Kirkegård
Kenzo eigentl. Kenzō Takada jap. 高田 賢三)
- geb. 27.2.1939 bei Himeji (Präfektur Hyōgo)
- gest. 4.10.2020 in Neuilly-sur-Seine (Frankreich)
Japanischer Mode- und Produktdesigner;
Das von ihm 1970 in Paris gegründete, weltweit tätige Mode- und Kosmetikunternehmen „Kenzo“ existiert bis heute, wird jedoch seit 1999 ohne Takada geführt.


Paris, cimetière du Père Lachaise
Hinweis: Beigesetzt wurden die sterblichen Überreste Kenzos im Grab von Fabrice Emaer.
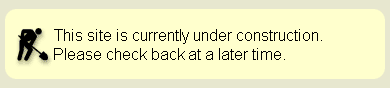


- geb. 30.11.1819 in Stockbridge (Massachusetts)
- gest. 12.7.1892 in New York City
US-amerikanische Geschäftsmann; achtes von zehn Kindern des kongregationalistischen Geistlichen Reverend David Dudley Field und dessen Frau Submit Dickinson, der Tochter von Captain Noah Dickinson aus dem Unabhängigkeitskrieg aus Somers in Connecticut, Bruder u.a. von Stephen Johnson Field, dem späteren 38. Richter des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten.
Im alter von 15 Jahren kam Field nach New York City, wo er als Laufbursche bei A.T. Stewart & Co., einem Textilwarenhändler, angestellt wurde und eine kaufmännische Lehre begann. Nach drei Jahren kehrte er nach Stockbridge zurück, kehrte aber später in seiner Karriere nach New York zurück, wo er als Kaufmann in kurzer Zeit zu großem Wohlstand gelangte.
1854 richtete er seine Aufmerksamkeit auf transozeanische Telegraphie und erwarb von der Regierung Neufundlands das ausschließliche Recht, ein Kabel von den USA dorthin und dann weiter nach Europa zu legen. Von dieser Zeit an widmete er der Sache sein ganzes Leben – die ersten auf diesem Gebiet errungenen Erfolge verdankt man großenteils ihm. Zusammen mit seinem Bruder und vier weiteren Geschäftspartnern gelang seinem Unternehmen schließlich, das erste Transatlantikkabel im Jahr 1858 zu verlegen.
Cyrus W. Field begleitete die Expeditionen von 1857 und 1858. Als nach wenigen Wochen festgestellt wurde, daß das Kabel nicht mehr funktionierte, wurde 1866 nach entspr. Veränderungen ein neues Kabel verlegt, an dessen Expeditionen von 1865 und 1866 Field ebenfalls teilnahm. Auch in den folgenden Jahren widmete Field sein Interesse dem Unterwassertelegraphen und 1871 war er einer der Hauptförderer der Linie durch den Pazifischen Ozean über Hawaii nach China und Japan.
Field war seit dem 2.12.1840 mit Mary Bryan Stone verheiratet; das Paar hatte sieben Kinder.


Stockbridge, (Berkshire County, Massachusetts) Cemetery
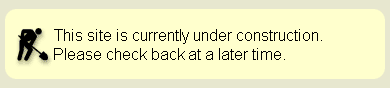
Inschrift (oben)
To Whose Courage Energy And
Perseverance The World Owes
The Atlantic Telegraph

- geb. 4.5.1842 in Wittenberg (Preußische Prov. Sachsen, heute Sachsen-Anhalt)
- gest. 8.2.1905 in Monte Carlo (Monaco)
Deutscher Unternehmer; Sohn eines Buchbindermeisters ging bei einem Klempnermeister in Cönnern (heute Könnern) im heutigen Salzlandkreis in die Lehre. Danach arbeitete er als Geselle in Wittenberg, Hannover, Köthen und Berlin. Seine in Köthen entwickelten Petroleumkochöfen stellte er auf der Leipziger Messe dem Publikum vor. 1872 heiratete er Bertha Emma née Illgner (*1851), die im gleichen Jahr in Dresden ein Klempnergeschäft übernahm. Dort stellte er Hauswirtschaftsgegenstände her, bevor seine Ehefrau das Geschäft nach fünf Jahren aufgab. Mit dem Kaufmann Julius Haußner gründete Eschebach zu jener Zeit das Klempnergeschäft Eschebach & Haußner zur Produktion von Haushaltsgegenständen, außerdem ließ er sich als Sommerhaus eine Villa auf dem Weißen Hirsch errichten.
arbeitete nach der Klempnerlehre in Könnern (heute Sachsen-Anhalt) als Geselle in Wittenberg und Hannover. Danach führte sein Weg über Köthen, wo er sich 1867 ein Geschäft zur Herstellung von Petroleumkochöfen aufbaute; im Jahre 1871 verzog Carl Eschebach nach Dresden, später kehrte er nach Berlin zurück.
Er stellte Blechwaren und Küchenmöbel her. und stieg innerhalb weniger Jahre vom Kleinunternehmer zu großem Wohlstand auf und wurde 1892 zum Kommerzienrat und 1898 zum Geheimen Kommerzienrat ernannt.


Dresden-Tolkewitz, Johannesfriedhof

![]()
- geb. 24.12.1886 in Köln
- gest. 17.11.1963 in Köln
Deutscher Unternehmer; Fußballspieler, DFB-Präsident; einer bürgerlichen, musisch geprägten Familie entstammend, wurde er - eher zum “weißen Sport”, dem Tennis, neigend - aus medizinischen Gründen von seinen Eltern zum Fußballspielen, einem “Prolentensport” angeregt, nachdem er aufgrund eines Unfalls beinahe ein Bein verloren hatte. Bereits als Schüler war er einer der Pioniere des Mittelrheinligisten SC Brühl, dem er ein Leben lang verbunden blieb. 1899 wechselte er zum KFC 1899 (dem späteren VfL Köln 1899) wo er sein fußballerisches Können so weit entwickelte, daß Bauwens, der ab Sommersemester 1907 bis 1913 (oder 1914) Rechtswissenschaften an der Universität Bonn studierte, 1910 zu einem Länderspieleinsatz in der deutschen Nationalmannschaft kam.
Nach dem Ersten Weltkrieg entschied er sich für die Laufbahn des Schiedsrichters, und leitete 76 Länderspielen, darunter das Finale bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin, und war damit der europäische Schiedsrichter mit den meisten Länderspielleitungen; zudem war er Schiedsrichter bei vielen deutschen Begegnungen bis hin zu Meisterschafts-Endspielen. Außerdem war er Fußball-Nationalspieler, internationaler Schiedsrichter und von 1950 bis 1962 erster Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach dem Zweiten Weltkrieg (insgesamt der fünfte), danach Ehrenpräsident des DFB.
Umstritten ist Bauwens’ Verhalten während der Zeit des Nationalsozialismus´; er war Mitglied der NSDAP, der er am 1. Mai 1933 mit der Mitgliedsnummer 2.103.982 beigetreten war (allerdings wurde er bereits ein Jahr später aus der Partei ausgeschlossen, da seine Frau Elisabeth, née Gidion, jüdischen Glaubens war). Sie nahm sich schließlich aufgrund der zunehmenden Schikanen seitens der Nationalsozialisten am 16.9.1940 das Leben. Seine Firma war in einer offiziellen Liste von 2.500 “Sklavenhaltern im NS-Regime“ der Alliierten vertreten; sie betrieb ein Zwangsarbeiterlager mit 100 Insassen.
Seit 1925 war er unternehmerisch im Baugeschäft tätig und in seiner Heimatstadt Köln Präsident der deutsch-belgisch-luxemburgischen Handelskammer. Er engagierte sich im Auftrag des DFB auch in Gremien des Weltfußballverbands FIFA, 1932 wurde er in dessen Exekutiv-Vorstand gewählt. Dabei trat er besonders dafür ein, daß der deutsche Verband - mit rund 8,3 Millionen Mitgliedern damals die größte Sportorganisation der Welt - eine wichtigere Rolle im Weltverband spielen sollte als die Verbände aus kleineren oder gar Zwergstaaten, die alle das gleiche Stimmrecht hatten.
Im Jahre 1950 wurde Peco Bauwens zum ersten Präsidenten des DFB nach dem Zweiten Weltkrieg gewählt. Er übte dieses Amt bis zum Jahre 1962 aus und wurde danach Ehrenpräsident,.
Bei der WM von 1958 in Schweden ordnete Peco Bauwens nach dem so genannten Skandalspiel von Göteborg, dem Halbfinale Schweden – Deutschland, aus Protest die sofortige Heimreise von Mannschaft und DFB-Funktionären nach dem Spiel um Platz drei an.


Köln, Friedhof Melaten
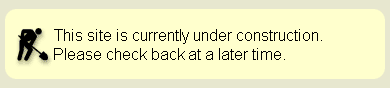
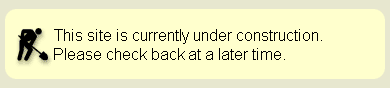
- geb. 1.4.1934 in Deebach (Ldkrs. Saalfeld-Rudolstadt (Thüringen), heute zu Schwarzatal)
- gest. 3.12.2017 in Leipzig
Deutscher Lektor und Verleger. nach einer Ausbildung im Postdienst und dem Abitur 1954 an der ABF, der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät in Jena schloß er von 1954 bis 1959 ein Studium der Germanistik in Leipzig an. Anschließend war er bis 1968 als Redakteur tätig, seit 1968 als Verlagslektor, dann seit 1970 Programmchef und seit 1975 Verleger von EDITION LEIPZIG, Verlag für Kunst und Wissenschaft. Von 1976 bis 1990 war Elmar Faber Vorsitzender des Verlegerausschusses des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig1; außerdem war er langjähriges Vorstandsmitglied der Pirckheimer-Gesellschaft für Buchkunst und Bibliophilie.
Von 1983 bis 1992 war Faber Verleger des 1945 in Berlin gegründeten Aufbau-Verlags, U.a. verlegte der Verlag in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) Werke von Christoph Hein, Christa Wolf, Erwin Strittmatter, Wolfgang Hilbig und Heiner Müller.
Nach der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahre 1990 gründete er mit seinem Sohn Michael seinen eigenen Verlag Faber & Faber .
In seinem 2014 herausgegebene AutobiographieVerloren im Paradies - Ein Verlegerleben blickt Faber auf sein Leben mit Büchern zurück.
----------------------------------------------------------------------------------------
1 Pendant zum 1948 in der späteren Bundesrepublik gegründeten Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main.



Leipzig, Südfriedhof

Omnibus salutem!